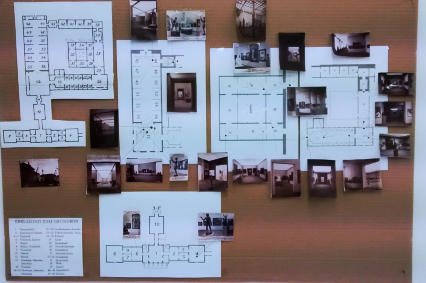Menü

01.04.2018 – 31.12.2020
Kunsthochschule Kassel der Universität Kassel
Leitung:
K.-U. Hemken
Assistenz und wissenschaftliche Mitarbeitende:
Simon Großpietsch, Linda-J. Knop
Studentische Mitarbeitende:
Julia Gens, Lisa-Maria Schmidt
Verbundpartner*innen:
Dr. Birgit Dalbajewa, Albertinum / Galerie Neue
Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden und
Prof. Uwe J. Reinhardt, M.A., edi Exhibition Design
Institute Hochschule Düsseldorf Peter Behrens
School of Arts
Gestaltung:
Linda-J. Knop
Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung der Bundesrepublik Deutschland
Vom Gegenstand zum Exponat.
Das Verhältnis von Objekt und Inszenierung in Ausstellungen des 20. und 21. Jahrhunderts.
Die Fallbeispiele Internationale Kunstausstellung 1926 in Dresden und der Raum für
konstruktive Kunst von El Lissitzky.
•
Assistenz
•
wissenschaftlicher Mitarbeiter
•
Organisation
•
Entwicklung und Ausarbeitung des kunstwissenschaftlichen Konzepts der virtuellen sowie
materiale Rekonstruktion des „Raum für konstruktive Kunst“ von El Lissitzky sowie der
Internationalen Kunstausstellung Dresden 1926
•
Provenienzforschung von etwa 800 Gemälden und 200 Skulpturen in insgesamt 56 Räumen der
Internationalen Kunstausstellung Dresden 1926
•
Ausstellungsmanagement sowie interne und externe Projektkoordination und -kommunikation
•
Leitungsverantwortung für das Team der Mitarbeiter*innen
•
Betreuung der Mitarbeitenden
Das kunstwissenschaftliche Forschungs- und Verbundprojektprojekt „Vom Gegenstand zum Exponat“
verfolgte das Ziel, das spannungsreiche Verhältnis von Objekt und Inszenierung in Ausstellungen
des 20. und 21. Jahrhunderts kritisch zu erschließen. Im Zentrum stand die Frage, ob ein Objekt aus
eigener Kraft zu sprechen vermochte oder ob es – wie Kurator*innen und Szenograf*innen
annehmen – stets einer vermittelnden Instanz bedurfte. Damit stellte sich die grundsätzliche Frage
nach der Autonomie des Exponates: Existierte eine authentische „Sprache der Objekte“ oder war
diese erst Ergebnis szenografischer Übersetzungsleistungen?
Foto: Simon Großpietsch.
Das Projekt nahm ein historisches Beispiel in den Blick: die Internationale Kunstausstellung 1926 in
Dresden sowie El Lissitzkys Raum für konstruktive Kunst (1926). Hier trat ein neuartiges
Spannungsverhältnis auf: Während die Ausstellungskonzeption von Hans Posse und Heinrich
Tessenow noch an einer weihevollen, national konnotierten Objektpräsentation orientiert war,
entwickelte Lissitzky eine experimentelle Szenografie, die sich an zeitgenössischen Leitmedien wie
Film und Fotografie sowie an Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie orientierte. Sein
Ausstellungsraum zielte auf eine veränderte Rezeptionsweise und transformierte das Kunstwerk
durch räumliche und mediale Setzungen. Damit stand die Frage im Raum, in welchem Maße
Szenografie das Objekt verstärkte oder instrumentalisierte.
Seit den 1990er-Jahren hatte sich die Szenografie zudem aus dem Ausstellungsdesign gelöst und als
eigenständige Disziplin etabliert. Sie übernahm nicht länger eine dienende Funktion, sondern
beanspruchte eigene Autorschaft und Deutungshoheit. Damit verschärfte sich die Frage nach dem
Verhältnis von Objekt, Inszenierung und Betrachter: War es die unmittelbare Objektsprache oder
erst die szenografische Vermittlung, die Bedeutungen sichtbar machte? Welche Rolle spielten die
kulturelle Konditionierung des Publikums und die Veränderungen durch Massenmedien,
Konsumkultur und soziale Netzwerke?
Das Forschungsprojekt verknüpfte historische Rekonstruktionen mit aktuellen Fragestellungen. Es
erschloss die Internationale Kunstausstellung 1926 über Archivrecherchen und rfealisierte sowohl
eine materiale 1:1-Rekonstruktion von Lissitzkys Raum als auch eine virtuelle Rekonstruktion der
gesamten Ausstellung. Diese Ansätze sollten nicht nur kunsthistorische Erkenntnisse sichern,
sondern auch neue Wege in der wissenschaftlichen Vermittlung eröffnen.
In interdisziplinärer Kooperation – zwischen Kunstwissenschaft, Ausstellungsdesign, IT-Forschung
und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden – wurden zentrale Leitfragen diskutiert:
- Existierte eine authentische Sprache der Objekte?
- Welche Funktion besaß die Szenografie – Verstärker oder eigenständige Instanz?
- Wie beeinflussten primäre und sekundäre Kontexte die Deutung von Objekten?
- Welche Rolle spielten die Dispositionen der Betrachter im Spannungsfeld von ästhetischer
und sozialer Erfahrung?
Die Ergebnisse flossen in Publikationen, Tagungen und experimentelle szenografische Formate ein.
Zugleich zielte das Projekt auf eine Ausstellung in Dresden, die die Aktivitäten progressiver Akteure
der 1920er-Jahre neu beleuchtete und anlässlich des Bauhaus-Jubiläums stattfand.



Vom Gegenstand zum Exponat.
Das Verhältnis von Objekt und Inszenierung in
Ausstellungen des 20. und 21. Jahrhunderts.
Die Fallbeispiele Internationale Kunst-
ausstellung 1926 in Dresden und der Raum für
konstruktive Kunst von El Lissitzky.
•
Assistenz
•
wissenschaftlicher Mitarbeiter
•
Organisation
•
Entwicklung und Ausarbeitung des
kunstwissenschaftlichen Konzepts der
virtuellen sowie materiale
Rekonstruktion des „Raum für
konstruktive Kunst“ von El Lissitzky
sowie der Internationalen
Kunstausstellung Dresden 1926
•
Provenienzforschung von etwa 800
Gemälden und 200 Skulpturen in
insgesamt 56 Räumen der
Internationalen Kunstausstellung
Dresden 1926
•
Ausstellungsmanagement sowie interne
und externe Projektkoordination und
-kommunikation
•
Leitungsverantwortung für das Team der
Mitarbeiter*innen
•
Betreuung der Mitarbeitenden
Das kunstwissenschaftliche Forschungs- und
Verbundprojekt „Vom Gegenstand zum
Exponat“ verfolgte das Ziel, das
spannungsreiche Verhältnis von Objekt und
Inszenierung in Ausstellungen des 20. und 21.
Jahrhunderts kritisch zu erschließen. Im
Zentrum stand die Frage, ob ein Objekt aus
eigener Kraft zu sprechen vermochte oder ob
es – wie Kurator*innen und Szenograf*innen
annehmen – stets einer vermittelnden Instanz
bedurfte. Damit stellte sich die grundsätzliche
Frage nach der Autonomie des Exponates:
Existierte eine authentische „Sprache der
Objekte“ oder war diese erst Ergebnis
szenografischer Übersetzungsleistungen?
Foto: Simon Großpietsch.
Das Projekt nahm ein historisches Beispiel in
den Blick: die Internationale Kunstausstellung
1926 in Dresden sowie El Lissitzkys Raum für
konstruktive Kunst (1926). Hier trat ein
neuartiges Spannungsverhältnis auf: Während
die Ausstellungskonzeption von Hans Posse
und Heinrich Tessenow noch an einer
weihevollen, national konnotierten
Objektpräsentation orientiert war, entwickelte
Lissitzky eine experimentelle Szenografie, die
sich an zeitgenössischen Leitmedien wie Film
und Fotografie sowie an Erkenntnissen der
Wahrnehmungspsychologie orientierte. Sein
Ausstellungsraum zielte auf eine veränderte
Rezeptionsweise und transformierte das
Kunstwerk durch räumliche und mediale
Setzungen. Damit stand die Frage im Raum, in
welchem Maße Szenografie das Objekt
verstärkte oder instrumentalisierte.
Seit den 1990er-Jahren hatte sich die
Szenografie zudem aus dem
Ausstellungsdesign gelöst und als
eigenständige Disziplin etabliert. Sie
übernahm nicht länger eine dienende
Funktion, sondern beanspruchte eigene
Autorschaft und Deutungshoheit. Damit
verschärfte sich die Frage nach dem
Verhältnis von Objekt, Inszenierung und
Betrachter: War es die unmittelbare
Objektsprache oder erst die szenografische
Vermittlung, die Bedeutungen sichtbar
machte? Welche Rolle spielten die kulturelle
Konditionierung des Publikums und die
Veränderungen durch Massenmedien,
Konsumkultur und soziale Netzwerke?
Das Forschungsprojekt verknüpfte historische
Rekonstruktionen mit aktuellen
Fragestellungen. Es erschloss die
Internationale Kunstausstellung 1926 über
Archivrecherchen und rfealisierte sowohl eine
materiale 1:1-Rekonstruktion von Lissitzkys
Raum als auch eine virtuelle Rekonstruktion
der gesamten Ausstellung. Diese Ansätze
sollten nicht nur kunsthistorische
Erkenntnisse sichern, sondern auch neue
Wege in der wissenschaftlichen Vermittlung
eröffnen.
In interdisziplinärer Kooperation – zwischen
Kunstwissenschaft, Ausstellungsdesign, IT-
Forschung und den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden – wurden zentrale
Leitfragen diskutiert:
- Existierte eine authentische Sprache
der Objekte?
- Welche Funktion besaß die Szenografie
– Verstärker oder eigenständige
Instanz?
- Wie beeinflussten primäre und
sekundäre Kontexte die Deutung von
Objekten?
- Welche Rolle spielten die
Dispositionen der Betrachter im
Spannungsfeld von ästhetischer und
sozialer Erfahrung?
Die Ergebnisse flossen in Publikationen,
Tagungen und experimentelle szenografische
Formate ein. Zugleich zielte das Projekt auf
eine Ausstellung in Dresden, die die
Aktivitäten progressiver Akteure der 1920er-
Jahre neu beleuchtete und anlässlich des
Bauhaus-Jubiläums stattfand.
01.04.2018 – 31.12.2020
Kunsthochschule Kassel der Universität Kassel
Leitung:
K.-U. Hemken
Assistenz und wissenschaftliche Mitarbeitende:
Simon Großpietsch, Linda-J. Knop
Studentische Mitarbeitende:
Julia Gens, Lisa-Maria Schmidt
Verbundpartner*innen:
Dr. Birgit Dalbajewa, Albertinum / Galerie Neue
Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
und Prof. Uwe J. Reinhardt, M.A., edi Exhibition
Design Institute Hochschule Düsseldorf Peter
Behrens School of Arts
Gestaltung:
Linda-J. Knop
Gefördert durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung der Bundesrepublik
Deutschland